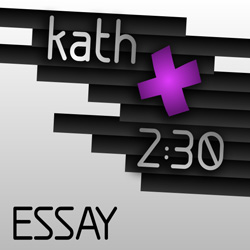 Eine Auseinandersetzung mit der Dresdner Rede 2014 von Sibylle Lewitscharoff
Eine Auseinandersetzung mit der Dresdner Rede 2014 von Sibylle Lewitscharoff
Es ist heute wahrhaft nicht schwer, das Etikett „Intellektuell“ zu bekommen. Man muss schreiben können und die Möglichkeit haben, das Geschriebene auch zu veröffentlichen. Stemmt man sich dann noch gegen den Zeitgeist – was auch immer das sein soll … – dann steht der Bewunderung der Feuilletonisten nichts mehr im Wege. Leser von Feuilletons sonnen sich dann gerne im Glanz der intellektuell Etikettierten. Und je weniger man beim Lesen versteht, desto intellektueller muss der Autor wohl sein. Der Philosoph Karl R. Popper hat diese Erfahrung am eigenen Leib gemacht. Er stellt im Nachgang einer Fernsehdiskussion, an der auch Ernst Bloch teilgenommen hat, fast mehr amüsiert als resigniert fest:
Es kam zu einigen unbedeutenden Zusammenstößen. (Ich sagte, wahrheitsgemäß, daß ich zu dumm bin, um seine Ausdrucksweise zu verstehen.) Am Schluß der Diskussion bat uns der Gesprächsleiter, Dr. Wolf gang Kraus: „Bitte sagen Sie in einem Satz, was Ihrer Meinung nach am meisten not tut.“ Ich war der einzige, der kurz antwortete. Meine Antwort war: „Etwas mehr intellektuelle Bescheidenheit.“ (Quelle: Die Zeit, Jahrgang 1971, Nr. 39 – kursiv im Original)
Diese Erfahrung führt Karl R. Popper zu einer polemischen Abrechnung mit den von ihm so genannten „dreiviertel Gebildeten“, deren Anmaßung
das Phrasendreschen [ist], das Vorgeben einer Weisheit, die wir nicht besitzen. Das Kochrezept ist: Tautologien und Trivialitäten gewürzt mit paradoxem Unsinn. Ein anderes Kochrezept ist: Schreibe schwer verständlichen Schwulst und füge von Zeit zu Zeit Trivialitäten hinzu. Das schmeckt dem Leser, der geschmeichelt ist, in einem so „tiefen“ Buch Gedanken zu finden, die er schon selbst einmal gedacht hat. (Wie heute jeder sehen kann – des Kaisers neue Kleider machen Mode!). (Quelle: Ebd.)
So kommt er zu folgendem Schluss:
Das Schlimmste – die Sünde gegen den heiligen Geist – ist, wenn die Intellektuellen es versuchen, sich ihren Mitmenschen gegenüber als große Propheten aufzuspielen und sie mit orakelnden Philosophien zu beeindrucken. (Quelle: Ebd.)
1 Kommentar
 Dies Domini – Erster Fastensonntag, Lesejahr A
Dies Domini – Erster Fastensonntag, Lesejahr A
die Eintönigkeit des Lebens ist unübersehbar. Alljährlich geben Psychologen kurz vor Weihnachten über Presse, Funk und Fernsehen Tipps, wie man das Fest der Liebe streitminimierend überstehen kann. Zu Karneval ist der Äther voll von Empfehlungen, wie der Kater derjenigen zu bekämpfen ist, die wissen, dass man nicht auf Knopfdruck lustig wird, sondern durch die Kenntnis und physische Anwendung der richtigen Formel, die in der Sprache der Chemiker C2H6O lautet. Und wenn sich dieser Dunst verflüchtigt hat, gilt das mediale Interesse alle Jahre wieder dem Thema Fasten in all seinen Facetten: Heilfasten, Entschlacken, Kopfdruck und Mundgeruch – der Überfluss all dessen verstopft die Ohren. Und wer es hier noch nicht gehört hat, wird sicher von seinen näheren Bekannten über deren Fastenziele informiert. Es gelingt dem Menschen offenkundig nicht, den Mund leer zu bekommen. Wer auf die Aufnahme von Nahrung verzichtet, muss diesen Verzicht offenkundig mit der Anhäufung von Worten kompensieren. Es ist eben nicht leicht, wirklich frei zu werden.
Viele von denen, die in dieser oralen Phase – Fasten hin, Fasten her – hängen geblieben zu sein scheinen, verknüpfen dann auch die genussvolle Aufnahme leiblicher Speise mit der Sünde. Zugegeben: Das geschieht meist mit scherzhaftem Unterton. Und doch ist die Häufigkeit, mit der dieses Spiel der Worte verwendet wird, geeignet, den Genuss im Laufe der Zeit als Sünde zu diskreditieren. Worüber lange genug geredet wird, das schafft eben auch ein Bewusstsein. Nicht umsonst sind die wortvergeudenden Zeitschriften mit den Frauennamen über das Jahr gefüllt mit Abnehmratgebern und Diättipps; in der Fastenzeit aber wird auch dort gefastet. Erstaunlich, wie wenigstens in diesem Bereich die christliche Tradition die säkulare Sphäre durchsäuert wie Sauerteig.
0 Kommentare
 Dies Domini – 8. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
Dies Domini – 8. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
Ein Schrecken ergreift die Menschen, wenn sie in Berührung mit dem Göttlichen kommen. Die Heilige Schrift kennt deshalb keine unmittelbaren Gottesbegegnungen. Die Herrlichkeit des Allmächtigen ist zu groß, als dass sie der Mensch ertragen könnte. So muss auch Mose sich von Gott belehren lassen, als er auf dem Sinai die Herrlichkeit Gottes schauen möchte:
Du kannst mein Angesicht nicht sehen; denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. (Exodus 33,20)
In der Heiligen Schrift jedenfalls begegnet Gott dem Menschen deshalb immer in vermittelter Weise. Mal sind es die Engel, hinter denen sich die Herrlichkeit Gottes verbirgt, mal wird die Erscheinung des Höchsten in Form von Naturereignissen geschildert. Niemals aber erscheint der, von dem man sich kein Bild machen darf, als raum-zeitliches Phänomen. Wer auch immer also behauptet, er habe in welcher Weise auch immer, einen mehr oder weniger unmittelbaren Kontakt zu Gott, müsste also entweder mindestens von Sinnen sein; andernfalls sollte er seine Wahrnehmung selbstkritisch überprüfen – wer weiß, was für Stimmen er gehört haben mag …
Der Schrecken hingegen ist ein untrügliches Zeichen für eine Begegnung mit dem Göttlichen. Kein Prophet im Alten Testament, der nicht vom Schrecken, dem φόβος τοῦ θεοῦ (sprich „phobos tou theou“ – Gottesschrecken), gepackt wurde, als er der Nähe Gottes gewahr wurde. Manch einer – wie Jona – ergreift gar die Flucht oder sucht – wie Jeremia mit Blick auf seine Jugend – Ausflüchte. Kein Wunder also, dass diejenigen, die selbst der vermittelten und verborgenen Gegenwart Gottes ausgesetzt sind, erst beruhigt werden müssen. Nicht umsonst lautet der Gruß der Engel: Fürchte dich nicht!
Wenn also die Begegnung mit Gott einen Ausdruck findet, dann ist es der Schrecken. Und vom Schrecken sind viele in diesen Zeiten ergriffen, die bisher noch sicheren Boden unter den Füßen zu haben glaubten. Man brauchte doch nur in den Katechismus schauen, um die sicheren Wahrheiten der katholischen Lehre vor Augen zu haben. Und manch einer kennt den Katechismus besser, als die Heilige Schrift, die doch immerhin das Wort Gottes ist.
0 Kommentare
 Dies Domini – 7. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
Dies Domini – 7. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
Der Ursprung des Glaubens ist nicht eine göttliche Offenbarung, sondern eine menschliche Ahnung – die Ahnung angesichts der Erkenntnis der eigenen Kleinheit und Schwäche angesichts der Größe der Welt. Es ist eine zuerst innerweltliche Ahnung, die dem modernen Menschen fast nicht mehr möglich ist. Für frühere Generationen genügte wohl ein Blick in die überwältigende Pracht eines unverstellten Sternenhimmels, um mit Staunen, aber ohne viele Worte vor die Frage geführt zu werden: Was ist der Mensch?
Weil diese Menschen sich angesichts der sie umgebenden kosmologischen Größe in Frage gestellt sahen, waren die Fragen nach Grund, Herkunft und Ziel des Menschen und seiner Existenz eine notwendige Folge. Fragen fordern zu Antworten heraus. Der Mensch ist das Wesen, das seiner Existenz Sinn verleihen muss. Die instinktive Sinnsuche liegt in den menschlichen Genen. Allerdings geht auch ein Tier nicht um des Beutemachens willen auf die Jagd, sondern um seine Existenz zu sichern, deren Gefährdung durch so etwas scheinbar Banales wie Hunger angezeigt wird. So folgt auch der Mensch seinem Sinninstinkt nicht ohne Grund. Es bedarf eines „Hunger“-Impulses, der den Sinninstinkt in Gang setzt.
Das Staunen ist ein solcher „Hunger“-Impuls. Das Staunen geht dem modernen Menschen immer mehr verloren. Es ist schon außergewöhnlich, überhaupt noch einen unverstellten Sternenhimmel zu sehen. So wurde unlängst der Nationalpark Eifel von der International Dark Sky Association zum Sternenpark erhoben, weil er zu den wenigen Orten gehört, wo der Sternenhimmel noch ohne Lichtverschmutzung angeschaut werden kann. Nirgends sonst in Deutschland ist die Milchstraße so unverstellt sichtbar.
0 Kommentare
 Zu den unzweifelhaften Helden meiner Kindheit gehörte Lefty, jener geheimnisvolle Verkäufer aus der Sesamstraße, der in der deutschen Fassung auch Schlemiehl heißt. Unvergessen die Szene, wie er dem seinerzeit nicht minder verehrten Ernie ein unsichtbares Eis verkaufen möchte. Natürlich ist das alles ganz geheim, und Lefty möchte kein großes Aufsehen um das unsichtbare Eis machen. Ernie aber, der ob der Kenntnis um dieses Geheimnis vor Glück platzen könnte, schreit es immer wieder hinaus: EIN UNSICHTBARES EIS!? – Genau … haucht Lefty, und mahnt Ernie zum Stillschweigen.
Zu den unzweifelhaften Helden meiner Kindheit gehörte Lefty, jener geheimnisvolle Verkäufer aus der Sesamstraße, der in der deutschen Fassung auch Schlemiehl heißt. Unvergessen die Szene, wie er dem seinerzeit nicht minder verehrten Ernie ein unsichtbares Eis verkaufen möchte. Natürlich ist das alles ganz geheim, und Lefty möchte kein großes Aufsehen um das unsichtbare Eis machen. Ernie aber, der ob der Kenntnis um dieses Geheimnis vor Glück platzen könnte, schreit es immer wieder hinaus: EIN UNSICHTBARES EIS!? – Genau … haucht Lefty, und mahnt Ernie zum Stillschweigen.
Diese Szene will mir einfach nicht aus dem Kopf gehen, wenn man sich manche zeitgenössische Entwicklung ansieht. Da wird ein Fall eines Bundestagsabgeordneten bekannt, der sich offenkundig moralisch zweifelhafte Fotos über das Internet besorgt hat. Mal ist von Kinderpornographie die Rede, mal von Fotos, die zwar legal aber doch sittlich fragwürdig seien. Da der Politiker angesichts der fortgeschrittenen Verhandlungen zur Bildung einer großen Koalition vor einem möglichen Karrieresprung stand und als Staatsekretär in Frage kam, informierte der Innenminister den nicht zu seiner Partei gehörenden Parteivorsitzenden des potentiellen Koalitionspartners, um größeren Schaden abzuwenden. Eine Dilemmasituation, wie sie nur die griechische Tragödie kennt: Sagst du nichts, handelst du rechtlich einwandfrei – aber du wirst einen möglichen Schaden nicht verhindern können. Sagst du etwas, brichst du dein Dienstgeheimnis. Der Innenminister wählte – moralisch verständlich – den ersten Weg, bat sich aber aus, die Angelegenheit vertraulich zu behandeln.
Auf welchen Wegen auch immer: Das Geheimnis bliebt nicht das, was es sein sollte. Allzu viele wussten schließlich davon und irgendwie verlor nicht nur das Geheimnis seinen Charakter. Wo zu viele Ernies sind, da wir eine Geheimnis seines innersten Wesens beraubt und hört auf, Geheimnis zu sein. Schwatzhaft rühmen sich viele, eine Geheimnis zu kennen. Das Wissen um ein Geheimnis ist offenkundig so schön, dass einige schier vor Stolz zu platzen scheinen und der Welt mitteilen müssen, sie wüssten etwas Geheimes. … Genau! Geheim! Kannst Du schweigen? Ich nicht!
1 Kommentar
 Dies Domini – 6. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
Dies Domini – 6. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
Der Fels erodiert zu Sandkörnern. Diesen Eindruck kann man bekommen, wenn man die Diskussionen verfolgt, die sich nicht erst seit der Veröffentlichung der Ergebnisse, die sich aus den Antworten auf Fragen des Vorbereitungsdokumentes zu dritten außerordentlichen Versammlung der Bischofsynode zu den pastoralen Herausforderungen der Familie im Kontext der Evangelisierung ergeben haben. Die Medien sind immer noch voll von den Meldungen, dass das Kirchenvolk offenkundig die offizielle Lehre der Kirche in den Fragen von Ehe, Familie und Sexualmoral nicht teilt. Dass dieser Bruch schon seit der Enzyklika „Humanae vitae“ (1968) von Papst Paul VI faktisch existiert, ist eigentlich kein Geheimnis gewesen. Umso überraschender ist die Überraschung, die jetzt allenthalben herrscht. Allzu viele scheinen in der katholischen Heimlichkeit die Augen vor der unheimlichen Wirklichkeit verschlossen zu haben.
Nun tritt aber nicht nur der Bruch zwischen amtlicher Lehre und der Realität der Lebenswirklichkeit der Glaubenden offen zutage. Auch der lange Zeit monolithisch erscheinende Block des Episkopates offenbart Risse, wie sie sonst nur im Gebirge sichtbar werden, wo das Auftauen des ewigen Eises Gerölllawinen und Felsstürze auslöst. Selbst die mächtigsten Gebirge sind dynamischen Veränderungen unterworfen. Auch ein Fels ist nicht für die Ewigkeit gemacht.
Die gegenwärtige Diskussion in Deutschland wurde vor allem durch eine Stellungnahme des Trierer Bischofs Stephan Ackermann ausgelöst, die in der Allgemeinen Zeitung (Rhein Main Presse) veröffentlicht wurde. In dem Bericht, der am 6. Februar 2014 veröffentlicht wurde, stellt Bischof Ackermann fest:
2 Kommentare
Die Offenbarung des Johannes zählt zu den herausfordernden Schriften des Neuen Testaments. Sie ist eine Trostschrift für die, die in schweren Zeiten, vielleicht auch in der Verfolgung leben. Ihnen gilt die Verheißung, dass Gott an ihrer Seite streitet und für die letzte Gerechtigkeit sorgen wird: Der auf dem Thron sitzt, spricht: Siehe, ich mache alles neu. Der Stuhl steht für den Thron Gottes. Gott selbst spricht seine Offenbarung auch in die heutige Zeit.
1 Kommentar
In Episode 31 präsentieren wir eine Animation zur „Offenbarung des Johannes“. Untermalt durch die Musik von Gustav Holst.
Bei iTunes.
Podcast: Download
Subscribe: Apple Podcasts | Android | RSS
1 Kommentar
 Dies Domini – 5. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
Dies Domini – 5. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
Worte können die Welt verändern. Und manches Wort ist schärfer als ein Schwert. Wer mit Worten umzugehen weiß, ist mächtig. Und dass Worte gefährlich sein können, erfahren gerade in der letzten Zeit viele Wortgewandte ganz gewaltig. Es ist nicht nur die unschickliche Bemerkung eines scheidenden Erzbischofs über die Bedeutung der Religionszugehörigkeit für den Wert von Familien, die vor kurzem für rechten Unbill und heilige Entrüstung sorgte. Auch andere, für die das Wortführen geradezu existentielle Bedeutung hat, haben erfahren müssen, dass gewandte Worte sich gegen den wenden können, der sie verwendet: Publizistinnen und Politiker, Politikerinnen und Publizisten setzen eben manchmal nicht nur schneidige verbale Attacken, sondern drehen mit Worten auch an der Wirklichkeit. Zuletzt waren es die Feministin und Publizistin Alice Schwarzer und der ehemalige NRW-Landesfinanzminister und CDU-Schatzmeister Helmut Linssen, die durch ihr Finanzgebaren die eigene Glaubwürdigkeit verschacherten.
Glaubwürdigkeit ist das eigentliche Kapital all derer, die mit Worten und vom Wort leben. Das Wort allein ist ein Nichts. Das Wort ist lediglich eine semantische Hülle für etwas, das es bezeichnet. Worte können solche Wirklichkeiten schaffen. Worte können wirken. Damit das gelingt bedarf es der Übereinstimmung von dem, was als Wort gesagt wird, und dem, was gemeint ist. Erst diese Kongruenz macht das Wort scharf und wirkmächtig. Fehlt diese Kongruenz, erweist sich ein gesprochenes Wort als hohl und gebrochen.
Die Macht des Wortes erweist sich erst in der Tat. Selbst die Schöpfungsmacht des göttlichen Wortes erweist sich erst darin, in dem die Schöpfung wirklich wird. Wahre Worte stehen in einer unauflösbaren Korrelation mit einer Tat, die dem Wort entspricht. Erst indem das Wort Fleisch wird, erweist es seine Wirkmächtigkeit. So erweist sich in der unüberbietbaren Fleischwerdung des göttlichen Wortes in Jesus Christus, dass Gottes Verheißungen mehr als hohle Wort sind: Gott ist treu!
0 Kommentare
 Das Bischofsamt erfreut sich in der Gegenwart einer neuen, bisweilen kritischen Aufmerksamkeit. Dabei ist es für die katholische Lehre von der Kirche (der sogenannten Ekklesiologie) von großer Bedeutung: Insofern die Bischöfe Nachfolger der zwölf Apostel sind, repräsentiert das Bischofskollegium die von Christus eingesetzte Leitung der Kirche.
Das Bischofsamt erfreut sich in der Gegenwart einer neuen, bisweilen kritischen Aufmerksamkeit. Dabei ist es für die katholische Lehre von der Kirche (der sogenannten Ekklesiologie) von großer Bedeutung: Insofern die Bischöfe Nachfolger der zwölf Apostel sind, repräsentiert das Bischofskollegium die von Christus eingesetzte Leitung der Kirche.
Konziliare Korrekturen
Der kollegiale Charakter der Kirchenleitung wurde durch das Zweite Vatikanische Konzil neu betont. Damit wurde eine Frage angegangen, deren Klärung notwendig war, nachdem das Erste Vatikanische Konzil 1870 vor allem die Autorität des Papstes und insbesondere das Dogma der Unfehlbarkeit des Papstes definiert hatte: Unfehlbar ist eine Aussage, wenn der Papst ex cathedra spricht, also sein Amt als „Lehrer aller Christen“ ausübt und eine Glaubens- oder Sittenfrage als endgültig entschieden verkündet. Das unfehlbare Lehramt des Papstes wird vom Zweiten Vatikanischen Konzil in der dogmatischen Konstitution Lumen gentium über die Kirche (LG) bestätigt. Das Konzil betont aber, dass es sich „das damals Begonnene fortführend, (…) entschlossen [hat], nun die Lehre von den Bischöfen, den Nachfolgern der Apostel, die mit dem Nachfolger Petri, dem Stellvertreter Christi und sichtbaren Haupt der ganzen Kirche, zusammen das Haus des lebendigen Gottes leiten, vor allen zu bekennen und zu erklären“ (LG 18).
1 Kommentar

